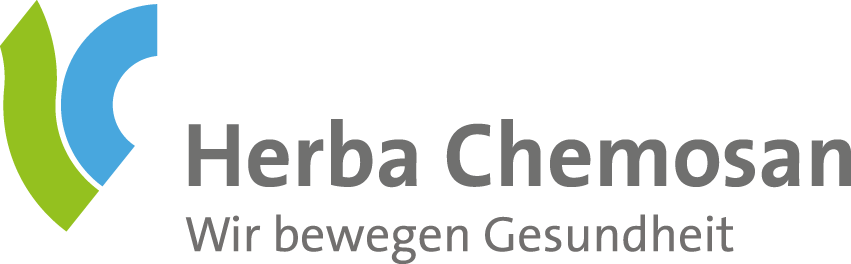An der Online-Umfrage zur Zukunft der Pharmazie beteiligten sich rund 230 Pharmazie-Studierende. Danach lud Herba Chemosan zum ersten Pharma.dialog in die Zentrale Wien, um mit rund 30 Studierenden und Aspiranten die Ergebnisse persönlich zu besprechen. Mit den Anwesenden diskutierte Mag. Martin Steidl, Verkaufsdirektor Herba Chemosan Wien; Mag. Corina Drucker, Chefredaktion Herba Impulse, führte durch den Abend. Der Pharma.dialog fand in Kooperation mit der Studienvertretung Pharmazie Wien der Österreichischen Hochschüler_innenschaft und dem AFÖP – Akademischer Fachverein Österreichischer Pharmazeut_innen statt.

Reinhard Gründler (StV Pharmazie): Meiner Meinung nach steht der Apothekenlandschaft eine breite Öffnung des Leistungsspektrums bevor. Der reine Verkauf von Arzneimitteln wird über kurz oder lang die Kosten nicht mehr decken, darüber hinaus rechtfertigt er nicht diese lange Ausbildung. Man wird sich also etwas überlegen müssen. Es liegt nahe, dass die Beratungsleistung in den Vordergrund rückt – das heißt natürlich auch, dass sie bezahlt werden muss.

Nawid Shayganfar (Aspirant im 4. Jahr): Ja, wir brauchen ein ganz anderes, neues Verrechnungssystem. Ich bediene täglich Kunden, die überhaupt nicht wissen, warum sie etwas einnehmen sollen. Nehme ich mir dann fünf oder 20 Minuten Zeit für diesen Patienten? Mit 20 Minuten könnte ich den Kunden vielleicht besser binden, wirtschaftlich geht sich das aber nicht immer aus. Wir haben ein sehr tiefgehendes Wissen erworben im Studium, das wir quasi gratis weitergeben, während die Marge auf das Medikament, zu dem wir beraten, immer kleiner wird. Dabei könnten wir erwiesenermaßen Milliarden im Gesundheitssystem sparen, wenn wir die Compliance des Patienten durch ausgiebige Beratung und Betreuung erhöhen.
Martin Steidl: Andere Länder sind da schon weiter. In Frankreich wird das System gerade umgestellt, weil man erkennt, dass es durch die sinkenden Margen nicht mehr finanzierbar ist. Pro Rezept wird ein Pauschalbetrag ausbezahlt, höhere Aufwände werden aber mit Zuschlägen abgegolten: z. B. bei besonders erklärungsbedürftigen Medikamenten oder Patientengruppen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie älteren Menschen. In den kommenden Jahren wird die Marge schrittweise weiter gesenkt, während die Pauschale angehoben wird.
Pascal Elsner: Ja, denn die Bedeutung der Pharmazie wird zweifelsohne zunehmen.
Dafür sprechen zahlreiche Entwicklungen wie die personalisierte Medizin und die Demografie bzw. Alterung der Gesellschaft. Wenn es einmal gelungen ist, die Beratungsleistung finanziell abzugelten, wird ein Quantensprung geschafft sein. Denn wir werden in Zukunft noch mehr gebraucht werden.
Nawid Shayganfar: Die Bevölkerung ist ja höchst zufrieden mit dem, was wir leisten, nur die Politik erkennt den Wert nicht.
Pascal Elsner: Genau. In einigen Bundesländern läuft ein Pilotprojekt zu einer Hotline, die die Ambulanzen entlasten soll. Patienten können 1450 wählen und mit diplomierten Pflegekräften sprechen. Von einem Freund, der dort arbeitet, habe ich erfahren, warum keine Pharmazeuten im Projekt sind: Unsere Kompetenz wird schlicht nicht gesehen. Die Politik versteht uns als Logistiker, wir werden nicht als Gesundheitsberuf wahrgenommen.
 |
 |
 |
Martin Steidl: Das schlägt sich auch im neuen Gesetz zu den Primärversorgungszentren
nieder. Dass die Apotheken darin kein substanzieller Bestandteil sind, tut schon weh.
Theresa Redinger: Was die PHCs leisten könnten, zeigen ihre Pendants in den USA, die Ambulatory Care Center. Dort hat sich gezeigt, dass die Kosten sinken, wenn Pharmazeuten eingebunden sind, weil durch ihre gute Arbeit Wechsel- und Nebenwirkungen abnehmen. Die Versicherungen geben daher jenen Praxen, die Pharmazeuten einbinden, mehr Geld, und das hat dazu geführt, dass mittlerweile der klinische Pharmazeut fixer Bestandteil des Teams ist. Für dieses ungeheure Potenzial im Sinne der Patienten herrscht hierzulande noch zu wenig Bewusstsein. Dazu sollte es auch mehr Kommunikation mit der Ärztekammer geben.
Theresa Redinger: Sie ist nicht vorhanden!
Nawid Shayganfar: Es braucht auch eine starke Standesvertretung. Ich finde, die Apothekerkammer könnte gegenüber der Ärzteschaft ruhig selbstbewusster auftreten.
Es ist kein Verhältnis auf Augenhöhe …
Reinhard Gründler: … was aufgrund unseres Fachwissens und auch der Dauer unserer Ausbildung aber gerechtfertigt wäre.
Katrin Bachinger: Das Ideal ist das Berufsbild des klinischen Pharmazeuten, der bei der Morgenvisite mit dem Arzt mitgeht und ihn berät, um Wechsel- und Nebenwirkungen
zuvorzukommen.
Reinhard Gründler: Das ist aber leider derzeit allzu oft Wunschtraum. Ich habe kürzlich mit der Leiterin der Apotheke eines großen Spitals gesprochen. Sie hat erzählt, dass sie vor 40 Jahren genau mit dieser Vision der Zusammenarbeit ihre Arbeit angetreten hat: Der Apotheker geht mit dem Arzt mit. In vier Jahrzehnten – sie steht knapp vor ihrer Pensionierung – kam es aber leider nicht dazu. Es wird nicht so gelebt. Da muss man schon fragen, warum.
Thorsten Hofbauer: Es ändert sich aber. Ich durfte vor zwei Jahren im AKH ein Praktikum machen, wo ich mit genau diesem klinischen Pharmazeuten bei der Visite mitgegangen bin. Vom zuständigen Primar hab ich erfahren, dass das relativ neu ist. Es ist ein kultureller Wandel: Die älteren Ärzte empfinden es als Einmischung, die jungen aber erkennen, dass ihnen sehr viel Arbeit abgenommen wird, und schätzen es.
Nawid Shayganfar: Auch im niedergelassenen Bereich haben wir da noch einen Weg vor uns. Ich glaube, auf der Station sieht der Facharzt eher den Nutzen, denn er muss sich nicht mehr so intensiv mit der Medikation auseinandersetzen. Ich erlebe Situationen, wo ich den Allgemeinarzt anrufe und ihm sage, dass ich dem Patienten ein Medikament nicht abgeben kann, weil der Facharzt etwas verschrieben hat, was der Allgemeinarzt nicht wusste. Nicht alle Ärzte nehmen das als konstruktiven Beitrag auf.
Rhian Hofmann: Man sollte ja eigentlich meinen, die Kooperation von drei umliegenden Ärzten mit einer Apotheke wäre leichter zu managen als ein ganzes Krankenhaus.
Martin Steidl: Offenbar müssen die Kompetenzen und Grenzen neu ausverhandelt werden, nicht zuletzt im Hinblick auf den drohenden Ärztemangel bei einem gleichzeitig großen Angebot an Pharmazeuten. Wie löst man dieses Spannungsfeld?
Robert Zika: Wo sonst hat die Bevölkerung Zugang zu einer akademischen Gesundheitsfachkraft von 8 bis 18 Uhr, mit vielleicht 2 bis 3 Minuten Wartezeit? Die Apotheker können sehr gut triagieren, und das sollte man nutzen. Mit Präventionsmaßnahmen kann man sehr viel Geld sparen, Stichwort Impfen. Das Argument rechtlicher Bedenken, das in diesem Zusammenhang oft geäußert wird, lasse ich nicht gelten – andere Länder machen vor, wie man das löst. Es geht darum, die Ärzte zu entlasten und das Gesundheitssystem bestmöglich finanzierbar zu machen.